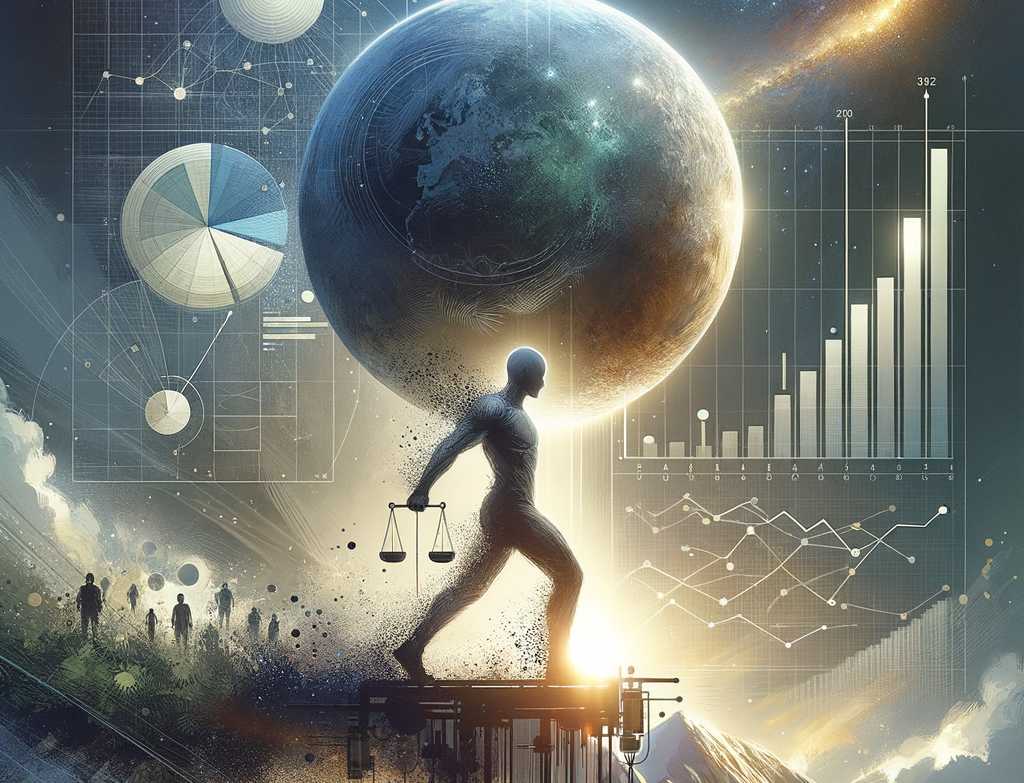„Was vererben wir eigentlich – Fotoalben oder Passwörter?“ Stell dir eine Truhe vor, die nicht im Dachboden steht, sondern unter einer englischen Wiese ruht: Beton, Stacheldraht, dahinter Serverreihen, die unser digitales Leben kühlen und bewachen. So sieht die neue Archäologie der Gegenwart aus. Das, was wir „Cloud“ nennen, trägt hier Gummistiefel.
In Kent steckt ein ehemaliger Bunker der Royal Air Force—gebaut in den 1950ern als Schaltzentrale des Radars—heute tiefenhin ein hochgesichertes Rechenzentrum der Cyberfort Group. Ähnliche Metamorphosen haben längst Kultstatus: Pionen in Stockholm, der Bond-verdächtige Schutzraum; Mount10 als „Swiss Fort Knox“ in den Alpen; Iron Mountain in einem amerikanischen Kalksteinlabyrinth; das norwegische Staatsarchiv in Bergstollen südlich des Polarkreises; und auf Spitzbergen die Arctic World Archive, inspiriert vom benachbarten Global Seed Vault—nur dass hier nicht Bohnenkörner, sondern Bits für künftige Neustarts lagern. Der Bunker als Gattung hat sein Thema gewechselt: von Bombenangst zu Backup-Angst.
Beton schlägt Metapher. Die Wolke mag poetisch klingen, doch sie hat Türen, Schlösser, Kühlschleifen, Stromtrassen—und sie ist verwundbar. Neben Hackern gibt es ganz ordinäre Gegner: Einbruch, Sturm, Sabotage in „hybriden“ Angriffen. Der Krieg in der Ukraine zeigte, wie gezielte Schläge auf digitale Infrastruktur Netze stocken lassen und Datenmigration über Landesgrenzen erzwingen. Kein Zufall, dass Regierungen Rechenzentren zur kritischen Infrastruktur zählen; Ausfälle sind ökonomische Kettenreaktionen. Man erinnere sich an den globalen Knick durch den Cloudflare-Fehler 2020, den Fastly-Aussetzer 2021, die mehrstündige Meta-Durststrecke im selben Jahr—und 2024 den CrowdStrike-Vorfall, der Supermärkte, Arztpraxen, Bahnen und Banken zugleich stolpern ließ. Minuten kosten: vierstellig bis fünfstellig. Pro Minute.
Ausgerechnet das Versprechen von „Überalligkeit“ führt zurück zur Geografie. Wo Daten liegen, entscheidet, welches Recht für sie gilt. Datenhoheit bedeutet: Ein britisches Unternehmen, das in US-Zentren speichert, landet unter US-Standards—nicht deckungsgleich mit britischen. Deshalb verkaufen Anbieter „Souveränität“ über Standorte, nicht nur über Verschlüsselung.
Die Ökonomie der Ewigkeit verlangt jedoch Tribut. Rechenzentren verschlingen Strom und Wasser—global im Bereich von rund einem Prozent des Strombedarfs, Tendenz steigend—und sichern sich Verfügbarkeit mit Dieselgeneratoren. Bis 2030 könnte die Branche Milliarden Tonnen CO2 emittieren. Während KI neue Bauwellen lostritt, wächst der Lärm realer Lüfter und die Ungeduld der Nachbarschaften. Einige Betreiber betonen Gegenzüge: erneuerbare Lieferketten, geschlossene Kühlsysteme. Doch das Grunddilemma bleibt: Dauer kostet Energie.
Wer das Thema nur bei Staaten und Konzernen verortet, unterschätzt die intimen Dimensionen. Die meisten von uns besitzen inzwischen eine kleine Privatarchäologie aus Fotos, Chats, Mails. Plattformen erziehen uns sanft zur ewigen Bewahrung—„archivieren“ statt löschen—während Geräte weniger lokalen Speicher und weniger Erweiterungsports mitbringen. Der Wechsel des Anbieters? Theoretisch möglich, praktisch mühselig und teuer: Terabytes herunterladen, sichern, hochladen. „Lebenslange“ Cloud-Angebote versprechen Sorglosigkeit, doch der Markt ist volatil; Marken fusionieren, Standorte schließen, Geschäftsmodelle kippen. Und während wir zögern, plant allein das Vereinigte Königreich hunderte neue Rechenzentren in den nächsten Jahren—einige davon wieder in Bunkern, manche sogar neu gebaut.
Hier liegt der Moment für Politik und Design, nicht für Fatalismus. Vier Vorschläge, um den Weg aus der Goldgruben-Metaphorik hin zur Haushaltskunst der Daten zu finden:
– Klick-Wechsel für Daten: Ein gesetzlich verankertes Portabilitätsprotokoll nach Vorbild des Kontowechsels im Bankwesen—inklusive verschlüsseltem Zwischenspeicher, Bandbreitengutscheinen und Kompatibilitätsgarantie für Metadaten. Daten sollten Umzüge so leicht machen wie Lastschriften.
– Öffentliche Kaltarchive: Eine kulturelle „Samenbank“ für Formate und Bestände von öffentlichem Interesse—offene Standards, dokumentierte Checksummen, georedundant, kuratiert wie ein Museum. Nicht alles gehört dorthin, aber das, was die Gesellschaft in 100 Jahren verstehen will.
– CO2-Preisschild pro Gigabyte: Sichtbare Klimaetiketten für Speichernutzung, dynamisch je nach Energiequelle und Region. Ergänzt um „Slow-Cloud“-Tarife, die nur bei erneuerbaren Überschüssen synchronisieren—günstiger, langsamer, klimafreundlicher.
– Datenfasten als Feature: In Betriebssysteme und Apps gehören Werkzeuge für periodisches, reversibles Aufräumen—„Ablaufdatum“, „Jahresinventur“, „Erinnerungssteuerung“—damit Löschen nicht als Verlust, sondern als Pflege gilt. Dazu ein Erbrecht für Daten: Voreinstellungen, die Belastungen vermeiden statt sie zu vererben.
Bunker sind am Ende eine Zeitmaschine: Sie sollen Inhalte aus einer unsicheren Gegenwart in eine ungewisse Zukunft tragen. Darin schwingen große Namen mit—Virilio, Sebald, Ballard—und das Bild der Pyramide, die den Erbauer überlebt. Doch die digitale Pyramide hat ein neues Problem: Selbst wenn das Gehäuse Jahrhunderte hält, sind Formate, Schlüssel und Lesegeräte morgen schon alt. Dauer ergibt sich weniger aus Beton als aus Portabilität, Offenheit und Energieintelligenz.
Angeregt durch aktuelle Umbauten alter Schutzräume und Debatten in der Open-Source-Welt lässt sich sagen: Unsere Zivilisation wird sich nicht daran messen lassen, wie tief sie Festplatten vergrub, sondern wie gut sie Bedeutung konservierte, ohne den Planeten zu verheizen. Vielleicht stoßen künftige Archäologen tatsächlich auf eine grasüberwachsene Kuppel in Kent. Wünschenswert wäre, dass sie den Inhalt nicht nur finden, sondern auch verstehen—andernfalls bleibt von der großen Datensammelzeit nur ein sehr gut gekühltes Schweigen.